Krieg der Zeichen
Culture Jamming als ästhetische Taktik des Widerspruchs
Perspektiven für eine kritische Kunst im öffentlichen Raum
ist der Arbeitstitel für eine kunsthysterische Dissertation (Christian Hartard) an der Uni München, deren Abstract im Netz verfügbar ist.
Das wird in der Tat eine Fleißarbeit.
Im kunsthistorischen Kontext muss CJ offensichtlich als "ästhetische Taktik" reklamiert werden. Soll mir aber mal eine/r erklären, warum bei Hartard der Begriff Kommunikationsguerilla so konsequent umschifft wird. Ist das der Versuch culture jamming als ein rein ästhetisches Projekt zu reklamieren? Werden hier Claims abgesteckt? Dass er das übersehen hat, kann man angesichts der identischen Literaturliste fast nicht glauben. Auch bei den angegebenen Links müsste er darüber gestolpert sein ... zumal andere in dem Kontext mit dem Begriff auch keine Schwierigkeiten haben. So etwas enthüllen mitunter auch Vorworte, manchmal sind es die akademischen Betreuer, die ein Aber gegen etwas haben usw.
via sum1
Culture Jamming als ästhetische Taktik des Widerspruchs
Perspektiven für eine kritische Kunst im öffentlichen Raum
ist der Arbeitstitel für eine kunsthysterische Dissertation (Christian Hartard) an der Uni München, deren Abstract im Netz verfügbar ist.
Das wird in der Tat eine Fleißarbeit.
Im kunsthistorischen Kontext muss CJ offensichtlich als "ästhetische Taktik" reklamiert werden. Soll mir aber mal eine/r erklären, warum bei Hartard der Begriff Kommunikationsguerilla so konsequent umschifft wird. Ist das der Versuch culture jamming als ein rein ästhetisches Projekt zu reklamieren? Werden hier Claims abgesteckt? Dass er das übersehen hat, kann man angesichts der identischen Literaturliste fast nicht glauben. Auch bei den angegebenen Links müsste er darüber gestolpert sein ... zumal andere in dem Kontext mit dem Begriff auch keine Schwierigkeiten haben. So etwas enthüllen mitunter auch Vorworte, manchmal sind es die akademischen Betreuer, die ein Aber gegen etwas haben usw.
via sum1
kg2u - am Donnerstag, 13. Januar 2005, 09:20 - Rubrik: KG in der Universitaet
Über den meist (5x) getorteten Mann und den dümmsten Phiolosphen Frankreichs, Bernard-Henry Lévy, erscheint nun eine Biographie ("BHL, une biographie", Fayard) von Philippe Cohen.
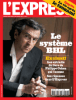
Im französischen L'Express (6.1. 2005) gibt es daher ein ganzes Dossier mit Auszügen aus der Cohen-Biographie sowie ein Interview mit dem gehypten "Intello-Star"
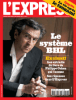
Im französischen L'Express (6.1. 2005) gibt es daher ein ganzes Dossier mit Auszügen aus der Cohen-Biographie sowie ein Interview mit dem gehypten "Intello-Star"
kg2u - am Dienstag, 11. Januar 2005, 13:05 - Rubrik: Torten - Pies - Tarts
kg2u - am Dienstag, 11. Januar 2005, 10:12 - Rubrik: Aktionsvorschlaege
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
 Der liebe Mark Dery, ja der mit der merkwürdig leporellohaften Broschüre zum "Culture Jamming", das ich damals irgendwann Mitte der 90er Jahre in Amsterdam erstanden habe, und der Kommunikationsguerilla in einem persönlichen Gespräch mit Sonja Brünzels als "Baader-Meinhof meets Baudrillard" bezeichnete, bloggt jetzt auch. Und ausserdem macht er sich auch noch über die Culture Jammer lustig. Die Broschüre von 1993 jedenfalls bewirbt er mit folgender launigen Ankündigung.
Der liebe Mark Dery, ja der mit der merkwürdig leporellohaften Broschüre zum "Culture Jamming", das ich damals irgendwann Mitte der 90er Jahre in Amsterdam erstanden habe, und der Kommunikationsguerilla in einem persönlichen Gespräch mit Sonja Brünzels als "Baader-Meinhof meets Baudrillard" bezeichnete, bloggt jetzt auch. Und ausserdem macht er sich auch noch über die Culture Jammer lustig. Die Broschüre von 1993 jedenfalls bewirbt er mit folgender launigen Ankündigung."No fashion-forward Anti-Corporate Rebel wants to be caught dead at the next Reverend Billy protest without a copy of the manifesto that started it all. Buy into the anti-consumption craze that's becoming the lifestyle choice of the radical chic!"
Na jetzt wissen wir wenigstens, wer den Ursprung des Begiffs für sich reklamiert.
contributor - am Samstag, 8. Januar 2005, 21:05 - Rubrik: Culture Jamming
Martin Wassermair von Public Nebase (Wien) streift in dem im übrigen sehr lesenswerten unten verlinkten Beitrag zur Wiener Veranstaltungsreihe von "living room - Medien als politische Räume" eine Diskussion, die 1994 vom Electronic Art Ensemble (CAE) begonnen wurde. Nämlich die Debatte über das Verhältnis zwischen virtuellem Raum und 'real life'. Das CAE postulierte einen strategischen Kurswechsel (Geert Lovink 2003) politischer Aktionen weg von der Straße - hinein in den Cyberspace. Zuletzt hat sich Konrad Becker in den Kulturrissen ("Terror, Freiheit und Semiotische Politik" in: Kulturrisse Nr. 3/4 2004, S. 32-33) in ähnlicher Weise geäußert. Die autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe hingegen zeigte sich bereits 1998 in "Vorsprung durch Technik? Internethype, Kommunikationsguerilla und Widerstand" skeptisch gegenüber dieser Position:
"Wie bereits angedeutet, sehen wir im Netz die Chance, neue Formen kollektiven Handelns zu schaffen. Kollektiv muß unter den bestehenden Bedingungen nicht gleichgesetzt werden mit vereinsähnlichen oder parteiartigen, festen Strukturen. Mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten verändern sich auch kollektive Strukturen. Sie können aus Netzwerken bestehen, die gemeinsame Ziele verfolgen und sich gegenseitig unterstützen, vielleicht auch nur immer wieder punktuell zusammenarbeiten.
Der entscheidende Punkt ist für uns also nicht, was sich alles aus der Real World ins Netz hineinverlegen läßt, sondern vielmehr, ob sich die dort unter Umständen leichter zu knüpfenden Netzwerke als soziale Zusammenhänge auch im Real Life materialisieren lassen. Wir sind auf der Suche nach der neuen Qualität der sozialen Zusammenhänge, nach “Links” statt nach verbindlichen Vereinsstatuten. Wir vermuten beweglichere, informellere und mehr an Zielsetzungen orientierte Kollektive im Gegensatz zu auf eine gemeinsame Identität ausgerichtete Gruppenbildungen. "
Den Mächtigen eine lange Nase drehen ...
Taktische Netz- und Medienkultur als politische Positionierung
Martin Wassermair im Dezember 2004
(...) In ihren Überlegungen zum Elektronischen zivilen Ungehorsam zeigte sich das Critical Art Ensemble bereits vor Jahren davon überzeugt, dass "die Straße, soweit es um Macht geht, totes Kapital" sei, "wertlos für Staat und herrschende Klasse". Um mit dieser Einsicht Wirkung zu entfalten, sollten insbesondere aktivistische Strategien darauf abzielen, sich "irgendetwas anzueignen, das für ihre Gegner Wert und Bedeutung hat. Nur so kommen sie in die Lage, über Veränderungen verhandeln (oder gar sie fordern) zu können". Einen ähnlich lautenden Zugang formuliert auch die auf Medien- und Kommunikationsguerilla spezialisierte autonome a.f.r.i.k.a. gruppe. Es brauche, so wird betont, "eine politische Positionierung, die sich nicht auf theoretische Analyse in den Begrifflichkeiten der Soziologie und Kulturtheorie beschränkt, sondern auch in Bildern denkt und Zeichensysteme zu nutzen weiß". Und nicht zu vergessen: "Zorn und Genervtheit und der Wunsch, der Macht eine lange Nase zu drehen, führen oft wirksamer als rationales Nachdenken zum Erkennen der Bruchstellen und Widersprüche im dominanten Diskurs."
1. Aus der Einleitung dieses Diskussionsbeitrages geht bereits ein Unterschied zum CAE hervor.
2. auch auf die Gefahr hin, dass es hier langsam langweilig wird, mit "Medienguerilla" haben wir nichts zu tun, dass ist ein Begriff der versucht Kommunikationsguerilla zu fetischisieren, wie das insbesondere in der immer knapp daneben liegenden Kommunikationsguerilladefinition bzw. Herleitung in Wikipedia vorgeführt wird.
3. Praktisch umgesetzt haben die Überlegungen von Martin Wassermair in jünster Zeit eben Public Netbase gemeinsam mit den Einsern und Nullern auf dem Wiener Karlsplatz mit der Nikeground-Aktion. Kommunikationsguerilleras sind also nicht in einem bestimmten Raum effektiv, sondern dann, wenn sie in allen sozialen (medialen wie physischen) Räumen, die hegemoniale Symbolproduktion zu subvertieren in der Lage sind. Ob der mediale Raum hierfür mehr als andere Räume geeignet ist, erscheint uns der falsche Ansatz. Vielmehr hat sich die Verknüpfung dieser Räume in konkreten Aktionen als besonders effizient erwiesen. Ein aktuellerer Beitrag zu den Interventionsmöglichkeiten im Internet erschien im Dezember 2004 in analyse + kritik.
Der folgende Absatz dreht sich um die Frage der Allianzenbildung und erneut um die Nutzung des virtuellen Raumes zu politischen Aktionen:
"Netz- und Medienaktivismus kann - noch umfassendere Betrachtungen sind im Buch Dark Fiber des Medientheoretikers Geert Lovink nachzulesen - auf verschiedenen Ebenen zur Anwendung gelangen. Eine Ebene sieht die Kommunikation innerhalb der Bewegung vor. Im Vordergrund steht dabei die Kommunikation in Mailinglisten und die Entwicklung von kollaborativen Plattformen zum internen Austausch von Ideen und Diskursbeiträgen, die wiederum für die taktische Ausrichtung von Bedeutung sind. Hinsichtlich der Bildung von Allianzen ist - auf einer zweiten Ebene - die Vernetzung zwischen Bewegungen und sozialen Gruppen dringend anzuraten. Das Ineinandergreifen verschiedener politischer Kontexte schafft zudem eine motivierende Umgebung, in denen auch neue Aktivitätsformen erprobt werden können, die von einer breiteren Basis getragen sind und dadurch auch mehr Wirkung entfalten können. Auf einer dritten Ebene eröffnet die Nutzung des Internet die Möglichkeit, rein virtuelle Interventionen durchzuführen, die keine Bezüge zum realen Raum haben müssen und daher in der Lage sind, durch ihre Unberechenbarkeit nachhaltige Irritationen zu erzeugen und durch temporäre Störungen der kognitiven Gewohnheiten Nachdenkprozesse einzuleiten. Dazu noch einmal die autonome a.f.r.i.k.a. gruppe, die alle hier genannten Ebenen zueinander in Verbindung setzt. Eine Netz- und Medienkultur, die politische Position einnehmen will, ist demnach eng "verbunden mit Gegenöffentlichkeit und bezieht sich auf Themen und Anliegen sozialer Bewegungen. In den letzten Jahren haben sich diese Bewegungen neue Technologien zu eigen gemacht, vom Handy über die Nutzung (und Fälschung) von zunehmend interaktiven Websites und Videos zum Live-Streaming."
1. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, erscheinen uns die virtuellen Räume zwar als eine Möglichkeit, aber auch nicht mehr. So ganz klar ist uns eigentlich nicht, warum wir immer als Protagonisten dieser Aktionen angeführt werden. Vgl. a. etwa auch dieses Interview.
2. Wobei sich die autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe eher für die Entwicklung einer Widerstandskultur, denn für das Wohl- und Wehe einer "Netz- und Medienkultur" oder gar der Netzkunst interessiert. Ihr ist auch die "politische Kunst" wurscht und insbesondere wie Kunst heutzutage politisch sein kann, sondern sie will einfach die Verhältnisse umwälzen, in denen der Mensch ... usw. Sie fragt danach, wie können künstlerische Methoden eingesetzt werden, damit die Verhältnisse zum Tanzen gebracht werden und insbesondere den meisten jetztigen Geldgebern von Kunst der Geldhahn abgedreht werden. Es geht ihr schlicht und ganz altmodisch auch um die Abschaffung der Kunst bzw. derjenigen gesellschaftlichen Verhältnisse die Kunst überhaupt benötigen. So plakativ darf man ja zu Jahresbeginn einmal daherkommen ....
Erschienen ist der Text von Martin Wassermair in: Reader SOHO in Ottakring 2005. Online findet sich der ganze Text hier.
"Wie bereits angedeutet, sehen wir im Netz die Chance, neue Formen kollektiven Handelns zu schaffen. Kollektiv muß unter den bestehenden Bedingungen nicht gleichgesetzt werden mit vereinsähnlichen oder parteiartigen, festen Strukturen. Mit den neuen Kommunikationsmöglichkeiten verändern sich auch kollektive Strukturen. Sie können aus Netzwerken bestehen, die gemeinsame Ziele verfolgen und sich gegenseitig unterstützen, vielleicht auch nur immer wieder punktuell zusammenarbeiten.
Der entscheidende Punkt ist für uns also nicht, was sich alles aus der Real World ins Netz hineinverlegen läßt, sondern vielmehr, ob sich die dort unter Umständen leichter zu knüpfenden Netzwerke als soziale Zusammenhänge auch im Real Life materialisieren lassen. Wir sind auf der Suche nach der neuen Qualität der sozialen Zusammenhänge, nach “Links” statt nach verbindlichen Vereinsstatuten. Wir vermuten beweglichere, informellere und mehr an Zielsetzungen orientierte Kollektive im Gegensatz zu auf eine gemeinsame Identität ausgerichtete Gruppenbildungen. "
Den Mächtigen eine lange Nase drehen ...
Taktische Netz- und Medienkultur als politische Positionierung
Martin Wassermair im Dezember 2004
(...) In ihren Überlegungen zum Elektronischen zivilen Ungehorsam zeigte sich das Critical Art Ensemble bereits vor Jahren davon überzeugt, dass "die Straße, soweit es um Macht geht, totes Kapital" sei, "wertlos für Staat und herrschende Klasse". Um mit dieser Einsicht Wirkung zu entfalten, sollten insbesondere aktivistische Strategien darauf abzielen, sich "irgendetwas anzueignen, das für ihre Gegner Wert und Bedeutung hat. Nur so kommen sie in die Lage, über Veränderungen verhandeln (oder gar sie fordern) zu können". Einen ähnlich lautenden Zugang formuliert auch die auf Medien- und Kommunikationsguerilla spezialisierte autonome a.f.r.i.k.a. gruppe. Es brauche, so wird betont, "eine politische Positionierung, die sich nicht auf theoretische Analyse in den Begrifflichkeiten der Soziologie und Kulturtheorie beschränkt, sondern auch in Bildern denkt und Zeichensysteme zu nutzen weiß". Und nicht zu vergessen: "Zorn und Genervtheit und der Wunsch, der Macht eine lange Nase zu drehen, führen oft wirksamer als rationales Nachdenken zum Erkennen der Bruchstellen und Widersprüche im dominanten Diskurs."
1. Aus der Einleitung dieses Diskussionsbeitrages geht bereits ein Unterschied zum CAE hervor.
2. auch auf die Gefahr hin, dass es hier langsam langweilig wird, mit "Medienguerilla" haben wir nichts zu tun, dass ist ein Begriff der versucht Kommunikationsguerilla zu fetischisieren, wie das insbesondere in der immer knapp daneben liegenden Kommunikationsguerilladefinition bzw. Herleitung in Wikipedia vorgeführt wird.
3. Praktisch umgesetzt haben die Überlegungen von Martin Wassermair in jünster Zeit eben Public Netbase gemeinsam mit den Einsern und Nullern auf dem Wiener Karlsplatz mit der Nikeground-Aktion. Kommunikationsguerilleras sind also nicht in einem bestimmten Raum effektiv, sondern dann, wenn sie in allen sozialen (medialen wie physischen) Räumen, die hegemoniale Symbolproduktion zu subvertieren in der Lage sind. Ob der mediale Raum hierfür mehr als andere Räume geeignet ist, erscheint uns der falsche Ansatz. Vielmehr hat sich die Verknüpfung dieser Räume in konkreten Aktionen als besonders effizient erwiesen. Ein aktuellerer Beitrag zu den Interventionsmöglichkeiten im Internet erschien im Dezember 2004 in analyse + kritik.
Der folgende Absatz dreht sich um die Frage der Allianzenbildung und erneut um die Nutzung des virtuellen Raumes zu politischen Aktionen:
"Netz- und Medienaktivismus kann - noch umfassendere Betrachtungen sind im Buch Dark Fiber des Medientheoretikers Geert Lovink nachzulesen - auf verschiedenen Ebenen zur Anwendung gelangen. Eine Ebene sieht die Kommunikation innerhalb der Bewegung vor. Im Vordergrund steht dabei die Kommunikation in Mailinglisten und die Entwicklung von kollaborativen Plattformen zum internen Austausch von Ideen und Diskursbeiträgen, die wiederum für die taktische Ausrichtung von Bedeutung sind. Hinsichtlich der Bildung von Allianzen ist - auf einer zweiten Ebene - die Vernetzung zwischen Bewegungen und sozialen Gruppen dringend anzuraten. Das Ineinandergreifen verschiedener politischer Kontexte schafft zudem eine motivierende Umgebung, in denen auch neue Aktivitätsformen erprobt werden können, die von einer breiteren Basis getragen sind und dadurch auch mehr Wirkung entfalten können. Auf einer dritten Ebene eröffnet die Nutzung des Internet die Möglichkeit, rein virtuelle Interventionen durchzuführen, die keine Bezüge zum realen Raum haben müssen und daher in der Lage sind, durch ihre Unberechenbarkeit nachhaltige Irritationen zu erzeugen und durch temporäre Störungen der kognitiven Gewohnheiten Nachdenkprozesse einzuleiten. Dazu noch einmal die autonome a.f.r.i.k.a. gruppe, die alle hier genannten Ebenen zueinander in Verbindung setzt. Eine Netz- und Medienkultur, die politische Position einnehmen will, ist demnach eng "verbunden mit Gegenöffentlichkeit und bezieht sich auf Themen und Anliegen sozialer Bewegungen. In den letzten Jahren haben sich diese Bewegungen neue Technologien zu eigen gemacht, vom Handy über die Nutzung (und Fälschung) von zunehmend interaktiven Websites und Videos zum Live-Streaming."
1. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, erscheinen uns die virtuellen Räume zwar als eine Möglichkeit, aber auch nicht mehr. So ganz klar ist uns eigentlich nicht, warum wir immer als Protagonisten dieser Aktionen angeführt werden. Vgl. a. etwa auch dieses Interview.
2. Wobei sich die autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe eher für die Entwicklung einer Widerstandskultur, denn für das Wohl- und Wehe einer "Netz- und Medienkultur" oder gar der Netzkunst interessiert. Ihr ist auch die "politische Kunst" wurscht und insbesondere wie Kunst heutzutage politisch sein kann, sondern sie will einfach die Verhältnisse umwälzen, in denen der Mensch ... usw. Sie fragt danach, wie können künstlerische Methoden eingesetzt werden, damit die Verhältnisse zum Tanzen gebracht werden und insbesondere den meisten jetztigen Geldgebern von Kunst der Geldhahn abgedreht werden. Es geht ihr schlicht und ganz altmodisch auch um die Abschaffung der Kunst bzw. derjenigen gesellschaftlichen Verhältnisse die Kunst überhaupt benötigen. So plakativ darf man ja zu Jahresbeginn einmal daherkommen ....
Erschienen ist der Text von Martin Wassermair in: Reader SOHO in Ottakring 2005. Online findet sich der ganze Text hier.
kg2u - am Samstag, 8. Januar 2005, 13:20 - Rubrik: Anstrengungen zum Begriff
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
An der altehrwürdigen Bologneser DAMS entstehen jetzt auch Qualifikationsarbeiten zum Thema Kommunikationsguerilla. Als Beispiel dient in dieser Hausarbeit RTMark.
Guerriglia della comunicazione su Internet: il caso ®™ark
di Federica Corbellini
[Ricerca realizzata per il Corso di Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa(prof. Pier Luigi Capucci), DAMS, Università di Bologna, A.A. 2001/2002.
Guerriglia della comunicazione su Internet: il caso ®™ark
di Federica Corbellini
[Ricerca realizzata per il Corso di Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa(prof. Pier Luigi Capucci), DAMS, Università di Bologna, A.A. 2001/2002.
contributor - am Freitag, 7. Januar 2005, 22:59 - Rubrik: KG in der Universitaet
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen
Die Verbindung von Kunst und Politik will die Konferenz KLARTEXT! in Berlin vom 14. bis zum 16. Januar ausloten. Dabei sind internationale Künstler eingeladen, die über die Möglichkeiten politischer Interventionen durch künstlerische Mittel diskutieren wollen, ihre Arbeiten zeigen und anschliessend Workshops anbieten (Deborah Kelly, Yes Men, Fiambrera Obrera, Grupo de Arte Callejero, u.a.). Der Kongress soll die gesellschaftliche Rolle von Kunst neu bestimmen, zu einem Zeitpunkt da behauptet wird, sie habe eine Repolitisierung erfahren. Dass dabei die richtigen Fragen gestellt werden sollen - "Kommt dem Politischen vielleicht nur eine Alibifunktion zu, mit deren Hilfe der Kunstbetrieb sein Bewusstsein reinigt? Macht es überhaupt Sinn, die Kunst als Artikulationsmittel für gesellschaftliche und politische Anliegen zu nutzen? Kann Kunst als ein wirksames Mittel zur Veränderung oder zum Widerstand gegen hegemoniale Macht genutzt werden oder ist sie dazu verdammt ist, eine dekorative, irrelevante Fußnote zu Kräften zu sein, die stärker sind als ihre Fähigkeit zur Konfrontation? Welche Formen sollte eine solche Kunst annehmen? Und in welchem Kontext kann sie wirksam auftreten?" (Programm) - lässt auf ein paar spannende Tage hoffen.
Volker_Schlicht - am Donnerstag, 6. Januar 2005, 17:55 - Rubrik: Kunst und Politik
noch kein Kommentar - Kommentar verfassen